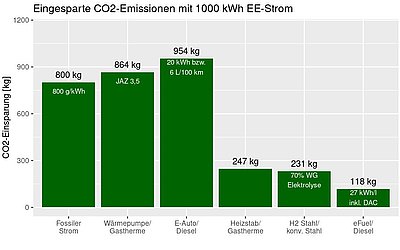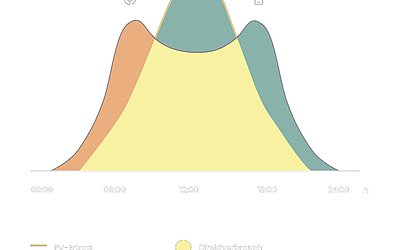PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Photovoltaik: Technik, Kosten & Betrieb einfach erklärt!
Nach dem endgültigen Aus für Atomkraft in Deutschland und der sich immer weiter verschärfenden Klimakrise ist der Begriff Photovoltaik in aller Munde. Der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen ist ohne die Photovoltaik gar nicht denkbar.
| 2,6 Millionen | installierte Photovoltaik Anlagen in Deutschland (Stand: März 2023) |
|---|---|
| 23 Prozent | Anteil an der erneuerbaren Stromerzeugung (Stand: erstes Halbjahr 2023) |
| 71,3 Gigawatt | installierte Gesamtleistung in Deutschland (Stand: Mai 2023) |
Denn die Photovoltaik ist eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative die Sonnenenergie in Strom zu verwandeln. Leistungsoptimierte Solarzellen mit immer besseren Wirkungsgraden sind zudem Garant für eine kostengünstige und sehr wirtschaftliche Nutzung von Solarenergie in Deutschland.
Viele wollen auf ihrem Dach daher eine Solaranlage installieren. Wir möchten Ihnen helfen und beantworten auf unserer Seite die wichtigsten Fragen zur Photovoltaik:

Photovoltaik-Grundlagen: Diese Fragen sollten Sie beantworten können
Mit einer Photovoltaikanlage wird über den sogenannten photoelektrischen Effekt in den Solarzellen Strom produziert. Eine einzige Solarzelle produziert jedoch nur wenig Strom, sodass mehrere Solarzellen zu Photovoltaik-Modulen zusammengefasst werden.
Um den gewonnen Gleichstrom zu nutzen, wird ein Wechselrichter benötigt, der den Strom in Wechselstrom verwandelt. Im Gegenzug für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz erhält der Betreiber die Photovoltaik Einspeisevergütung.
Wer sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet, sollte vorab einige Fragen klären. Schließlich soll die Anlage mindestens 20 Jahre Solarstrom produzieren und Gewinne erwirtschaften.
Folgende Punkte müssen beim Planen der PV-Anlage berücksichtigt werden:
- Verfügbare Dachfläche, Ausrichtung und Neigung
- Art und Qualität der Photovoltaik Module
- Investitions- und Betriebskosten
- Finanzierung mit Eigen- oder Fremdmitteln?
- Einspeisevergütung und sonstige Fördermittel
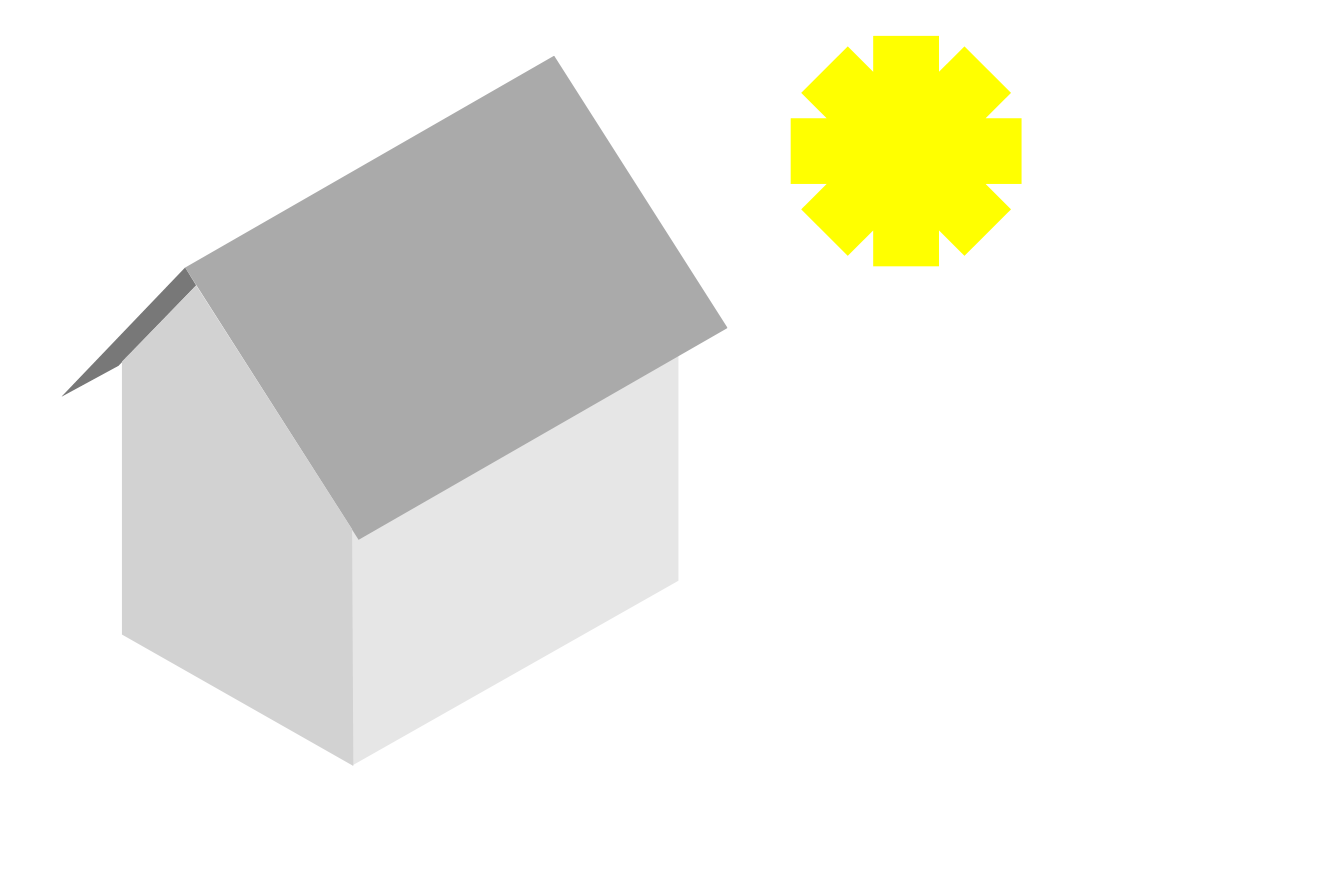
Der richtige Solar-Generator: Welche Photovoltaik-Module?
Viele Jahre waren polykristalline Photovoltaik-Module weit verbreitet, da sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Allerdings haben sie einen geringeren Wirkungsgrad als monokristalline Solarmodule.
Modul-Typen
Seit Anfang der 2020er Jahre dominieren hingegen monokristalline Module den Markt. Diese sind unter anderem wegen der aufwendigeren Produktion etwas teurer, erzielen dafür jedoch einen höheren Solarertrag.
Dünnschichtmodule, die - trotz geringeren Wirkungsgrades - gerade wegen günstiger Herstellungskosten einige Jahre insbesondere bei größeren Solaranlagen wie Freiflächenanlagen sehr beliebt waren, werden immer weniger nachgefragt. Ihr geringer Rohstoffverbrauch, die Flexibilität und die hohe Effizienz bei diffusen Lichtverhältnissen machen sie dennoch zu einer weiterhin guten Option in vielen Anwendungsfällen.
Die Entscheidung für einen bestimmten Modultyp hängt letztlich von Standortfaktoren, Strahlungswerten und Verschattungen ab.
| Glas-Folien Module | Glas-Glas Module |
|---|---|
| Gängiger Modul-Standard | Robuster & schwerer |
| Günstiger, aber kürzere Lebensdauer | Teurer, da 2 Glasscheiben |
| Leichter zu installieren | Höherer Ertrag, da teils bifazial |
Modulpreise
Die Photovoltaik-Preise hängen insbesondere von der Modulart und dem Hersteller ab. Während einzelne Hersteller auch wieder in Deutschland produzieren, kommen die allermeisten Module aus China.
Die Preise selbst sind in den letzten Jahren nicht mehr so stark gesunken und belaufen sich für Endkunden, die sich eine schlüsselfertige Solaranlage vom deutschen Fachbetrieb installieren lassen, auf Kosten pro kWp von rund 1.200 bis 1.400 €.
Experten gehen davon aus, dass die Photovoltaik Preise in Zukunft trotz unsicherer Rohstoffpreise und protektionistischen Maßnahmen dennoch weiter fallen werden. Kostenvorteile ergeben sich dabei u.a. durch geringeren formalen Aufwand (wie z. B. der Aufhebung der 70%-Regelung) und den Befreiung von der Mehrwert- und Einkommensteuer und der Abschaffung der EEG-Umlage seit Anfang 2023.
| Modulklasse | Beschreibung | Modulpreise pro Wattpeak |
|---|---|---|
| Low Cost | Minderleistungsmodule, B-Ware, Insolvenzware, Gebrauchtmodule (kristallin), Produkte mit eingeschränkter oder ohne Garantie | 0,11 Euro/Wattpeak |
| Mainstream | Standard-Module mit monokristallinen Zellen (auch TOPCon), die vorwiegend in gewerblichen Anlagen eingesetzt werden und einen Wirkungsgrad bis 22 % aufweisen. | 0,19 Euro/Wattpeak |
| High Efficiency | Kristalline Module mit mono- oder bifazialen HJT-, N-Typ-/TOPCon- oder IBC (Back Contact)-Zellen und Kombinationen daraus, welche Wirkungsgrade größer 22 % aufweisen. | 0,27 Euro/Wattpeak |
von Marion K. aus Ingelfingen
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENPhotovoltaik-Einnahmen: Wie verdient die Anlage Geld?
Einspeisevergütung
Zentrales Element zur Photovoltaik Förderung ist die Einspeisevergütung, die im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) festgelegt ist. Danach erhalten Betreiber für 20 Jahre für den ins öffentliche Netz eingespeisten Solarstrom eine Vergütung.
Die Höhe der Einspeisevergütung hängt vom Jahr der Inbetriebnahme ab, ist in dieser Höhe dann aber für 20 Jahre garantiert.
Mit dem EEG 2023 sind einige für PV-Anlagen positive Änderungen vorgenommen wurden:
- Es wird zwischen einer Volleinspeisung und einer Überschusseinspeisung unterschieden
- Ebenso wurde der Degressionsmechanismus pausiert. Erst ab dem 01.02.2024 gibt es wieder eine halbjährige Degression um je ein Prozent.
Bei einer Überschusseinspeisung - also dem klassischen Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch erhält man seit dem 01.08.2022 bis 10 kWp installierter Leistung 8,60 Cent pro kWh und 7,50 Cent pro kWh bei Solaranlagen bis 40 kWp.
Bei der Volleinspeisung ist sogar die Vergütung für Photovoltaik-Anlagen unter zehn Kilowatt installierter Leistung von 6,24 Cent pro eingespeister kWh auf 13,0 Cent – ein Anstieg auf gut das Doppelte!
Ab 1. Februar 2024 erhalten Betreiber:innen einer Eigenversorgungsanlage dann bis zu einer Leistung von 10 kWp8,11 Cent pro kWh. Ab 1. August 2024 gibt es 8,03 Cent pro kWh und ab 1. Februar 2025 nur noch 7,94 Cent pro kWh.
| Datum Inbetriebnahme | Überschuss-/ Voll-Einspeisung | bis 10 kWp | 10 bis 40 kWp | 40 bis 100 kWp |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 bis 31.07.2024 | Überschusseinspeisung | 8,1 Cents/kWh | 7 Cents/kWh | 5,7 Cents/kWh |
| Volleinspeisung | 12,9 Cents/kWh | 10,8 Cents/kWh | 10,8 Cents/kWh | |
| ab 01.08.2024 | Überschusseinspeisung | 8 Cents/kWh | 6,9 Cents/kWh | 5,6 Cents/kWh |
| Volleinspeisung | 12,8 Cents/kWh | 10,7 Cents/kWh | 10,7 Cents/kWh |
Eigenverbrauch
Die höchsten Einnahmen erzielen Sie aber dann, wenn Sie Ihren Solarstrom selbst verbrauchen!
Wenn Sie heute Strom von Ihrem Netzbetreiber einkaufen, zahlen Sie ca. 50 Cents pro kWh. Da Sie den Strom für teils 10 Cents Kosten produzieren, sparen Sie mit jeder kWh, die Sie nicht aus dem Netz kaufen müssen, 40 Cents!
Diese Ersparnis ist mehr als dreimal so groß wie der Erlös aus der Volleinspeise-Vergütung. Verglichen mit einem Netzstrombezug sparen Sie 80 % ihrer herkömmlichen Stromkosten.
Die Kosten: Mit diesen Kennzahlen sollten Sie rechnen!
Kleine Photovoltaik-Anlagen mit zehn Kilowatt installierter Leistung kosten aktuell im Schnitt rund 25.000 Euro inkl. Montage und Inbetriebnahme. Die Kosten pro kW sind mit 2.200 € - 2.800 € pro kWp installierter Anlagenleistung deutlich teurer als der Kauf der Module, da diese natürlich noch auf dem Dach installiert und mit dem Wechselrichter verkabelt werden müssen.
Zudem gilt: Je kleiner die Anlage, desto höher die Kosten pro kWp. Je größer die Photovoltaik-Anlage, desto kleiner die Kosten pro kWp!
Bauen Sie eine kleinere Anlage, sparen Sie, weil sie weniger Module brauchen. Allerdings entstehen die gleichen Fixkosten: Es muss trotzdem das gleiche Gerüst gestellt werden, die Anfahrtskosten bleiben die gleichen, die Planung ist ähnlich aufwendig und Sie benötigen trotzdem einen Wechselrichter. Auch müssen Kabel verlegt und der Zählerkasten angepasst werden. Das führt dazu, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für größere Photovoltaik-Anlagen oft wesentlich besser ist.
Stromspeicher-Kosten
Mit einem Photovoltaik-Speicher steigern Sie die Unabhängigkeit und den Eigenverbrauch Ihres Haushaltes deutlich. Überschüssige Energie wird gespeichert und steht Ihnen dann zur Verfügung, wenn Sie sie brauchen.
Allerdings sind mit dem Speichern auch Kosten verbunden. Als Faustformel können Sie mit 1.200 € - 1.400 € pro kWh installierter Speicherkapazität (netto) rechnen. Die Gesamtkosten - die LCOS (Levelized Cost of Storage) - umfassen dann alle zum Speichern einer Kilowattstunde anfallenden Kosten und belaufen sich heute auf 8 bis 10 Cents pro kWh je nach Speichermodell.
Möchten Sie die genauen Kosten wissen, sollten Sie sich ein auf Sie zugeschnittenes Photovoltaik-Angebot einholen.
Laufende Kosten im Betrieb
Neben den reinen Anschaffungskosten, bei denen übrigens auch Wechselrichter, Verkabelung, Montage, Zähler etc. berücksichtigt werden sollten, kommen noch laufende Kosten auf den Betreiber zu. Hierbei sind etwa Wartung und Instandhaltung, Reinigungskosten und die Versicherungsprämien zu nennen.
Für eine Photovoltaik-Versicherung und die Wartung der PV-Anlage können Sie im Schnitt mit ca. 80 € pro Jahr rechnen. Insgesamt sind diese Photovoltaik-Kosten jedoch vergleichsweise gering, sie machen circa ein bis zwei Prozent der Anschaffungskosten pro Jahr aus.
| Investition | 22.000 € |
|---|---|
| Laufzeit | 30 Jahre |
| Laufende Kosten | 80 € x 30 J = 2.400 € |
| Wechselrichter-Tausch | 1.500 € |
| Stromerzeugung pro Jahr | 10.000 kWh |
| Kosten pro kWh | (25.900 € / 300.000 kWh) = 8,6 Cents |
Photovoltaik-Ertrag: So berechnen Sie die Solar-Rendite!
Der Photovoltaik-Ertrag ist von vielen Faktoren abhängig. Durchschnittlich kann man aber von einem Jahresertrag einer Photovoltaikanlage von rund 800 bis 900 Kilowattstunden (kWh) PV-Strom pro Kilowatt Peak (kWp) ausgehen.

Um den Gewinn zu errechnen, müssen Sie nun die Kosten und den Photovoltaik-Ertrag gegenüberstellen:
Gewinn pro kWh = Ertrag pro kWh - Kosten pro kWh
Zur schnellen und unkomplizierten Berechnung der Wirtschaftlichkeit, bietet sich unser Photovoltaik-Rechner an. Neben dem voraussichtlichen Photovoltaik Ertrag fließen die ungefähren Investitionskosten in die Kalkulation mit ein.
Als vorläufige Prognose zur Wirtschaftlichkeit wird die Rentabilität unter Berücksichtigung der Einspeisevergütung und des Eigenverbrauchs berechnet. Selbstverständlich muss die Kalkulation später durch einen passenden Photovoltaik-Fachbetrieb verifiziert werden.
Letzte Aktualisierung: 04.01.2024